Apropos Édouard Louis
Édouard Louis zählt zu den wichtigsten Autoren Frankreichs. Seine Kindheit war geprägt von Armut und Gewalt. Doch sie ganz hinter sich lassen kann er nicht — gerade darüber schreibt er ja.
Bei APROPOS GEGENWART spricht Gabriel Proedl mit Édouard Louis über sein jüngstes Buch, über Herkunft & Literatur u.v.m. Da die Veranstaltung bereits ausverkauft ist, stellen wir Ihnen hier kostenlos das Porträt zu Verfügung das Gabriel Proedl im SZ Magazin veröffentlicht hat. Dafür hat er ihn 2021 über mehrere Monate hinweg begleitet.

Der Elende
von Gabriel Proedl
Édouard Louis wirft sich auf den Bühnenboden und weint. Er weint oft, manchmal mehrmals am Tag, aus Freude und Hoffnung oder aus Trauer, Wut und Scham. Er streckt die linke Hand, als würde er sich vor den Schlägen schützen wollen, die er so oft erfahren hat – mit tränenden Augen sieht er ins Bühnenlicht. Von der Seite ruft der Regisseur: »Das funktioniert noch nicht!« Louis wirft sich also wieder hin, weint, hebt die Hand, kämpft. Auf der Leinwand hinter ihm erscheint ein Film von ihm, es kommt zu einem Gespräch zwischen Louis im Video und Louis auf der Bühne. Eine Befragung – so heißt auch das Stück, das hier Anfang Mai 2021 am Niederländischen Theater Gent geprobt wird und später durch Europa touren soll, zuerst nach Brüssel, im Herbst an die Kammerspiele nach München, und nach Paris: THE INTERROGATION, die Befragung. Einziger Schauspieler des Stückes ist Édouard Louis, der 29-jährige Literaturstar aus Paris. Und wie in allen seinen Büchern geht es auch diesmal um ihn selbst – und um alles andere auch.
APROPOS GEGENWART
Édouard Louis: "Anleitung ein anderer zu werden"
Mit Édouard Louis und Gabriel Proedl. Es liest Markus Meyer
9. Februar 2023, Kasino
»Sind Sie krank?«, fragt Louis von der Leinwand.
»Nein«, sagt Louis auf der Bühne.
»Arbeiten Sie?«
»Ja.«
»Sind Sie glücklich?«
»Nein. Oh nein.«
Wieder der Regisseur von der Seite: »Noch mal! Es geht hier um deine Geschichte. Mach das mit mehr Lebensfreude!« Louis sieht ihn an. Der Regisseur ist sein guter Freund – aber gerade einfach nur Regisseur: Milo Rau, Theaterweltstar, bekannt dafür, erst dann einen Schritt zurückzutreten, wenn er bereits zwei zu weit gegangen ist.
Wenn Louis die Kontrolle entgleitet, senkt er sein Kinn zur Brust und weitet seine Augen, sein Blick wird starr. Seit er vor zehn Jahren von seiner homophoben und rassistischen Familie aus seinem verhassten Kindheitsort Hallencourt im Norden Frankreichs geflohen ist, hinterfragt er jeden Vorschlag, jede Anweisung, jeden Befehl. Er will die Kontrolle über seine Entscheidungen behalten, nur so fühlt er sich wohl, nur so kann er radikal sein. Er schreibt dann von seinem Vater, der gemeint habe, Schwule und Araber müsse man aufhängen, und davon, dass er in Paris vergewaltigt worden sei und beinahe ermordet. Doch wenn er schreibt, legt er nur das offen, was er möchte – als Schauspieler ist er den Anweisungen des Regisseurs ausgesetzt. Und als Rau nun also von ihm verlangt, mehr Lebensfreude in die Sätze zu bringen, sieht er ihn mit diesem starren Kontrollverlustblick an und sagt: »Milo, von Lebensfreude weiß ich rein gar nichts.«
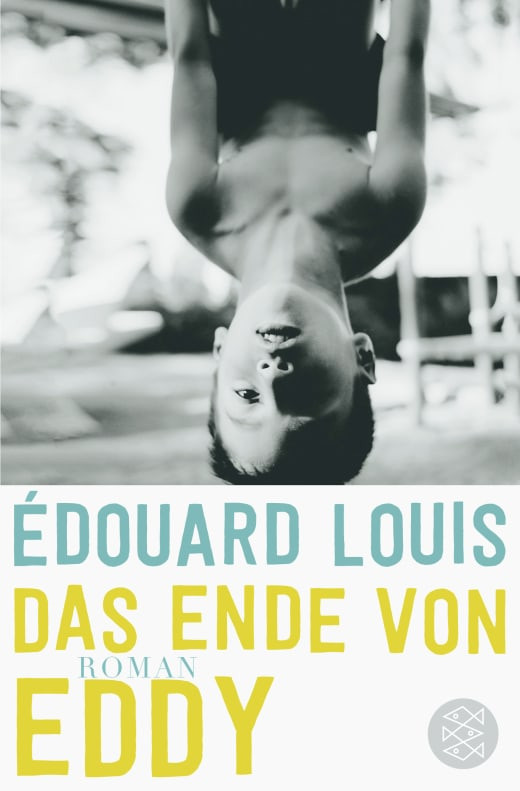
Das erinnert an die ersten Sätze seines Debüts „Das Ende von Eddy“ von 2014, dem ersten von fünf erschienenen autobiografischen Büchern: »An meine Kindheit habe ich keine einzige glückliche Erinnerung. Das soll nicht heißen, ich hätte in all den Jahren niemals Glück oder Freude empfunden. Aber das Leiden ist totalitär: Es eliminiert alles, was nicht in sein System passt.« Die New York Times schrieb in einem Text, die Stelle habe sich wie ein Pop-Hit verbreitet. Und spätestens seitdem ist Édouard Louis der Popstar: Seine Bücher wurden in dreißig Ländern verkauft, Louis ging auf weltweite Lesetournee und saß in vielen Talkshows.
Auf der Bühne breitet er jetzt die Arme aus, er steht aufrecht, als würde er an den Schulterblättern von einem Seil nach oben gezogen. Sein weißer Kapuzenpulli wird von vorne angestrahlt, seine kurzen blonden Haare leuchten. Édouard Louis hat seine Bestimmung darin gefunden, von seinen Visionen zu erzählen: von einem Leben ohne Gewalt. Rau fragt: »Wollen wir es noch einmal versuchen?« Louis sagt: »Ich weiß es nicht, Milo. Ich fühle mich nicht wohl. Ich spüre meinen Körper nicht.«
Fünf Wochen später, Anfang Juni 2021, in seinem Apartment in Paris. Édouard Louis wohnt im obersten Stock eines knallweißen Hauses in einem Wohnviertel links der Seine. Sein bester Freund ist der Literat Didier Eribon, er wohnt ein paar Straßen weiter, die beiden sehen sich jeden Tag. Seine Adresse hält Louis selbst vor seiner Familie geheim, seit sein Bruder mit Baseballschläger in die Stadt gekommen sei, um ihn zu erschlagen. Von einem Cousin wurde Louis gewarnt und floh in ein Hotel, erzählt er. Das war 2014, kurz nach der Veröffentlichung seines ersten Buches „Das Ende von Eddy“, bald ein literarischer Hit: Ein 21-Jähriger schreibt schonungslos seine Kindheitsgeschichte als homosexueller Junge in einer der ärmsten Regionen Frankreichs auf. Sein Vater arbeitete in der Fabrik und verbat seiner Frau zu arbeiten, sich zu schminken, »das ist was für Prostituierte«, soll er gesagt haben. Wann immer Édouard Louis den Stand seiner Familie beschreibt, bedient er sich eines Begriffes von Karl Marx: Lumpenproletariat. Jene, die nichts haben. Kaum Geld für Geschenke zu Weihnachten, zwar das Meer in der Nähe, doch sie fahren nie hin, weil Benzin teuer ist. Gegen Monatsende gibt es warme Milch als Hauptgericht.
Louis sagt: »In meiner Kindheit spürte ich ausschließlich Angst«
Louis sitzt an seinem Schreibtisch vor den handschriftlichen Notizen für seinen neuen Roman. Auf seinem Laptop hat er einen Virus, immer wieder poppen halbnackte Frauen auf. Aus einer Bluetoothbox läuft Lana Del Rey. Sein Regal biegt sich unter den vielen Büchern, Thomas Bernhard, Peter Handke, Elfriede Jelinek, von ihnen habe er die Radikalität gelernt. Die Luft steht, ein Thermometer zeigt 24 Grad. Louis’ blaue Augen glänzen schwarz. Sein Gesicht ist symmetrisch, obwohl er der festen Überzeugung ist, dass die linke Hälfte die schönere ist: Wenn er beobachtet wird, bedeckt er die rechte oft mit seiner Hand. In der Nacht ist er um vier ins Bett gegangen, erzählt er, und auch erst nach zwei Gläsern Wein, kombiniert mit einer Schlaftablette, Zolpidem, dem harten Zeug, so gehe das fast jeden Abend. Sein Arzt habe ihm geraten, besser mit Wein und Tabletten zu schlafen als gar nicht.
Sein Aufstieg vom Proletariat zu dem, was man von außen als Leben der Bourgeoisie bezeichnen würde, wurde oft geschildert. Von ihm selbst, in seinen Büchern, von Journalisten, etwa im Magazin der New York Times, die aus seiner Geschichte einen platten American Dream machten. Fast so, als wäre Édouard Louis mit 29 in seinem Happy-End-Leben angekommen, von warmer Milch zu kaltem Champagner, von einer verabscheuungswürdigen Familie zur intensivsten Freundschaft mit den führenden Linksintellektuellen Didier Eribon und Geoffroy de Lagasnerie. Oft wird vergessen, dass sein Leben ein Leben im Kampf gegen die Gewalt ist. Und dieser Kampf und dieses Leben finden jetzt statt, auf gedruckten Buchseiten und auf der Straße: in Paris traditionell jenem Ort, an dem eine Revolution beginnt. Milo Rau hat vielleicht intuitiv die richtige Form gefunden, ein solches Leben zu erforschen: eine Befragung.
Frage des SZ-Magazins: »Mit welchem Gefühl schreiben Sie, wenn Sie Ihre Geschichte erzählen?«
»Mit Wut. Und Angst«, sagt Louis. »Das Leben der Ärmsten ist geprägt von Angst. Angst, den Job zu verlieren, das Haus, die Pension. Sogar in meiner Kindheit spürte ich ausschließlich Angst, jeden Tag. Sie erfüllte mein ganzes Wesen.«
»Die Menschen in Ihrem Heimatdorf hassen Sie. Warum kämpfen Sie für diese Menschen, die – wie Sie schreiben – rassistisch und homophob sind?«
»Wer für eine Gruppe kämpft, muss nicht beweisen, dass sie es verdient. Ich kämpfe für leidende Menschen, ich kämpfe gegen objektive Bedingungen.«
»Was, wenn sie Ihre Hilfe nicht brauchen?«
»Vielleicht wissen sie es nicht, weil sie keinen Zutritt zu all dem haben. Meine Eltern beispielsweise dachten, das Leben muss hart und zerstörerisch sein. Doch sie waren gefangen in einem System.«
»Von dem Sie sie erlösen wollen?«
»Ja.«
»Kann man aus dem Leid ausbrechen?«
»Nicht vollständig, denke ich. Denn das Einzige, was sich immer wiederholt, ist die Gewalt.«
»Und die Liebe!«
»Und die Liebe.«
Ein Filmteam begleitet ihn seit drei Jahren, der Regisseur, François Caillat, und Louis kennen sich schon länger, seit zehn Jahren; damals schrieb Louis noch an seinem ersten Buch über seine Kindheit. Als er Caillat von der Idee erzählte, meinte der nur: »Jaja, ein Buch über die Kindheit, mach nur, viel Glück.« Der Film soll eine Dokumentation werden, wie Caillat es einst mit Peter Sloterdijk gemacht hat. An diesen heißen Frühsommertagen 2021 sind es die letzten Drehtage. Das Team trifft sich in einem Kostümverleih am Rande von Paris. Louis schlendert durch die Halle mit Kostümen, der Geruch alter Kleider hängt in den Gängen, Louis atmet tief durch. Er sucht T-Shirts und Jeans, wie die Menschen sie im Dorf seiner Kindheit tragen. Möglichst großer Kontrast zu seiner aktuellen Kleidung, den New-Balance-Turnschuhen, zugeknöpften Lacoste-Poloshirts oder Kapuzenpullis. Mit den Kostümen will er Schaufensterpuppen anziehen, die die Kulisse der Filmszene bilden sollen. Bei einer ärmellosen Tarnfarbenweste mit rosarotem Kunstpelz bleibt er stehen. Er hält sie sich vor die Brust. »Würdest du mit mir ausgehen, wenn ich das trüge?«, fragt er Caillat. »Sicher doch!«, sagt Caillat. Die beiden ziehen weiter, finden Trainingsanzüge und Jeans mit besetzten Kunststoffpailletten. Es ist die Kleidung seiner Kindheit, als er noch Eddy Bellegueule hieß, Eddy Schönmaul. Damals, als seine Eltern ihn ihm zufolge »Tussi« nannten und verlangten, das »Getue« zu lassen. »Reg dich ab, muss das sein, dieses tuntige Gefuchtel«, hätten sie gesagt.
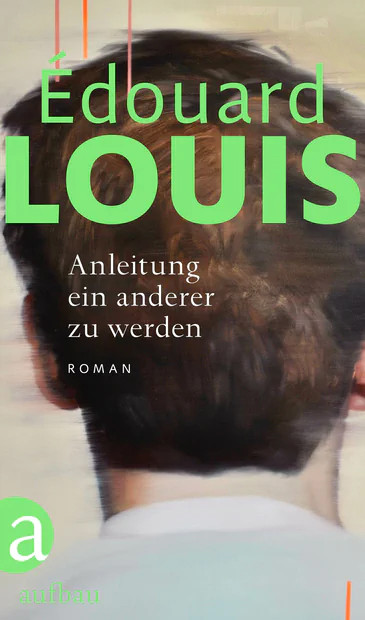
Louis legt die ausgewählte Kleidung auf einen Stehtisch und geht seine Mails durch. »Es ist hier«, ruft er, »das Layout meines neuen Buches ist hier, meine Odyssee!« Das Filmteam versammelt sich, Louis scrollt durch das PDF. 368 Seiten, mit Originalbildern seiner Kindheit: seine Mutter mit rundem Gesicht und glänzenden schwarzen Haaren, sein Vater mit Händen, deren Adern hervorquellen. Louis selbst einmal als schmächtiges Kind im Pokémon-Shirt, als seine Eltern meinten, er sei abgemagert, hässlich und »unmännlich«, und dann ein Jahr später: Aus Trotz hat er innerhalb dieser Zeit zwanzig Kilo zugenommen. »Mit diesen Fotos will ich den letzten Zweiflern zeigen: Alles, was ich schreibe, ist wahr«, sagt er. »Komm, Édouard, wir müssen drehen«, sagt Caillat.
In einem Teil der Kleiderhalle hat das Team eine Abstellkammer zu einem Filmstudio umgebaut, Louis sitzt in ihrer Mitte auf einem Hocker, mit Puder an der Nase und an den Wangen. Die Kamera läuft. Er schaut ernst in die Linse, als wollte er angreifen. Schriftsteller, die in Filmen lachen, mag er nicht. Zu schreiben bedeute zu kämpfen – und ein Schriftsteller müsse zu jeder Zeit beweisen, dass es in der Literatur um nichts weniger geht als um Leben und Tod.
»Wochenlang wollte ich am liebsten sterben«, schreibt Louis beispielsweise in seinem dritten Roman „Wer hat meinen Vater umgebracht“. Er habe gedacht, er werde sich an die Schmerzen und Demütigungen gewöhnen, wie Arbeiter sich an Rückenschmerzen gewöhnen. Doch irgendwann habe er das Leben in der Bruchbude nicht mehr ausgehalten, in der sie lebten. Die Fenster eingeschlagen, der Verputz ab, die Dachrinne gebrochen, die Tür von Efeu verwuchert. Der Vater, brutal wie alle Männer im Dorf. Und die Mutter, die über die Brutalität des Vaters klagte, wie alle Frauen im Dorf. Louis sagt, er wollte damals eher tot sein, als so zu sein, wie er war, weil er sich selbst abartig fand. Er begann, Schwule zu hassen, weil er dachte, sein Hass könne ihn selbst ändern.
Diese letzte Szene wird im Studio gedreht. Ein Beamer wirft Videoaufnahmen seines Geburtsorts Hallencourt auf eine Wand. Louis soll davor stehen und einen Absatz aus seinem zweiten Roman lesen, „Im Herzen der Gewalt“. Es geht um seine Schwester, die darin sagt, das Coming-out von Louis sei sein bewusster Versuch gewesen, Distanz zu seiner Familie und dem Ort seiner Kindheit aufzubauen. Im Bild hinter ihm: eine gepflegte Allee, die Ortszufahrt, rund herum gedroschene Kornfelder, Nordfrankreichklischeeschönheit. »Ich hasse diese Straße«, sagt Louis. Im Inneren seines Kopfes entsteht der Gestank von Gülle, den er noch mehr hasst, und der Gestank drückt nach außen, an die Kopfinnenwand, als würde es den Schädel zum Explodieren bringen, so beschreibt er es später. Sein Kinn senkt sich zur Brust, er weitet die Augen, sein Blick wird starr. »Ich fühle mich mit dieser Stelle nicht wohl«, presst Louis heraus, als stünde er kurz vor einem Kollaps. Die Szene wird gestrichen, François Caillat sagt: »Alles gut, wir haben’s, der Film ist im Kasten!« Louis reißt sich sein Funkmikrofon vom Pullover. Drehschluss nach zwei Jahren, aber niemand applaudiert, niemand liegt sich in den Armen. Édouard Louis zwinkert dem Regisseur und der Tontechnikerin zu, das war’s. Es sind drei Flaschen Sekt bereitgestellt, doch als die Korken knallen, ist Louis nicht im Raum. Er steht am Balkon und starrt auf den Boden. Auch später noch, als manche bereits nachgeschenkt haben, steht sein Glas noch unangetastet am Tisch.
»In Ihren Büchern geht es um Ihren echten Geburtsort, Hallencourt, im Film ziehen sogar Kameraaufnahmen davon vorbei. Als Literat hätten Sie den Ort auch erfinden können, auch um die Bewohner zu schützen.«
»Literatur funktioniert nur, wenn sie radikal und real ist. Es darf keine Fluchtmöglichkeit für den feigen Leser geben, der am liebsten bei jeder Seite sagen würde: Halb so schlimm, ist doch erfunden.«
»Ich war in Hallencourt. Es wirkt von außen wie das normalste Dorf der Welt: ein Café, ein Rathaus, ein Supermarkt …«
»Was dachten Sie, was Sie sehen? Erhängte Araber vor der Kirche und erschossene Schwule am Sportplatz? Nein, die Gewalt spielt sich wie so oft auf der zweiten Ebene ab. Gewalt ist von außen betrachtet meistens unsichtbar.«
»Ihre Familie, sagen Sie, hat Ihre Kindheit zerstört. Hatten Sie keine Angst, mit dem Buch deren Leben zu zerstören?«
»Diese Frage stellte ich mir nie, denn wenn ich schrieb, dachte ich nicht an meinen Vater und meine Mutter, sondern beispielsweise an die LGBT-Community. Diese Distanz hat mir geholfen, so schonungslos anzuprangern.«
»Was verstehen Sie unter Autobiografie?«
»Autobiografie ist es dann, wenn es gegen den Strich geht. Wenn du aus Angst oder Wut schreibst – es muss ein Risiko geben. Wenn du hingegen schreibst, was die Gesellschaft dich gelehrt hat zu schreiben, ist es keine Autobiografie, selbst wenn es um dich geht. Dann bist du der Sprecher der Bourgeoisie, der Chor des Kollektivs.«
»Im Stück von Milo Rau befragt der Schriftsteller Édouard Louis den Schriftsteller Édouard Louis. Auf den ersten Blick Theater der Bourgeoisie?«
»Ich habe das Stück mit Milo abgebrochen, obwohl ich es sehr gut fand.«
»Also kein Brüssel, kein München, kein Paris?«
»Nein, die Zusammenarbeit ist beendet. Ich liebe Milo sehr. Wir teilen politische Meinungen, und wir teilen einen Kampf. Vorerst haben wir nur noch keinen Weg gefunden, das auch künstlerisch zum Ausdruck zu bringen.«
»War’s das mit Ihnen und dem Theater?«
»Ach nein! Ich führe die Adaption meines dritten Romans bei der Biennale in Venedig auf. Regie führt Thomas Ostermeier.«
Kunst ist ein Experiment. Das ist einer dieser Édouard-Louis-Sätze. So arbeitet er: Versuch und Irrtum. Immer wieder lässt er künstlerische Zusammenarbeiten platzen, viele Projekte lehnt er ab, er lässt seinen Namen aus dem Abspann eines Spielfilms löschen, weil er mit der Umsetzung unzufrieden ist. Projekte beendet er, sobald er von anderen Leuten genervt ist oder er die Kontrolle über das Werk verliert. »All meine Zeit soll da sein für den Kampf gegen Gewalt«, sagt er.
Sein wichtigster Kampf in diesem Sommer soll in knapp einem Monat stattfinden, Mitte Juli, auf den Straßen eines Vorortes von Paris: Seine gute Freundin Assa Traoré kämpft seit fünf Jahren um Gerechtigkeit für ihren verstorbenen Bruder Adama. Dieser wurde 2016 von der Polizei festgenommen, weil er keinen Ausweis dabeihatte. Auf der Wache wurde er bewusstlos und starb – die diensthabenden Polizisten versicherten, sie hätten ihn in die stabile Seitenlage gebracht. In Traorés Freundeskreis glaubt daran niemand. Gestorben sei Adama an den brutalen, aber immer noch legalen Fesselmethoden der französischen Polizei. Die Autopsie könnte ihnen recht geben: Adama Traoré ist demnach an Sauerstoffmangel gestorben. Und auch ein Feuerwehrmann belastet die Polizisten: Als er ankam, sei der bewusstlose Traoré in Handschellen auf dem Bauch gelegen, das Gesicht zu Boden.
Die Demonstration »Gerechtigkeit für Adama« findet jährlich um dessen Todestag am 19. Juli statt. Dieses Jahr soll er besonders groß ausfallen, 5000 Menschen mindestens – die Videos von der Tötung des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis im Mai 2020 haben auch das mediale Interesse an diesem französischen Fall vergrößert. Außerdem ist Assa Traoré mittlerweile ihr eigenes Medium – 441 000 Follower hat sie auf Instagram, wo sie seit Wochen auf die Demonstration hinweist. Nebenbei läuft ein Prozess gegen sie: Weil sie die Namen der drei beteiligten Polizisten öffentlich genannt hatte, hat die französische Polizei sie verklagt.
In Venedig, in der Nähe der Rialtobrücke, haben sich die Zuschauer im Saal des Teatro Goldoni eingefunden. Es ist der 8. Juli 2021, etwas mehr als eine Woche noch bis zur Demonstration in Paris. Der G20-Gipfel tagt in der Stadt, die Straßen werden von Maschinenpistolen bewacht, und die Hubschrauber fliegen. Louis ist gerade aus Lissabon gekommen, gleich danach will er nach Cannes. Jetzt sitzt er bereits an einem Tisch auf der Bühne und tippt in seinen Laptop. Eine Dame in schwarzer Robe hat ihn entdeckt, zu ihrer Begleiterin sagt sie: »Oh, hier sitzt er schon.« Minutenlang starrt sie ihn an. In der vierten Reihe: Ein etwa dreißig Jahre alter Mann mit lockigen Haaren, eingekleidet in Gucci, an seinem Hals eine Goldkette mit Davidstern, in der Hand eine pinke Tasche. Er applaudiert Louis, noch bevor es losgeht, und dreht sich um die eigene Achse. Er ist einer von Louis’ besten Freunden aus New York, Adam Eli, bekannter LGBTQ-Aktivist. »In New York ist Édouard ein Superstar«, sagt er. »Wenn ich Freunden erzähle, dass ich ihn kenne, flippen die aus.« Die Amerikaner, sagt Eli, lieben seine Offenheit, seine Radikalität, seine Ehrlichkeit – und dann ist da natürlich noch die New York Times, die über den Debütroman schreibt: Die ersten Zeilen haben sich wie ein Pop-Hit verbreitet. »Was Besseres kann dir nicht passieren«, sagt Eli, »selbst wenn du eine Milliarde Dollar hättest, könntest du dir nie den Ruhm kaufen, den ihm die New York Times mit dieser Kritik gegeben hat.«
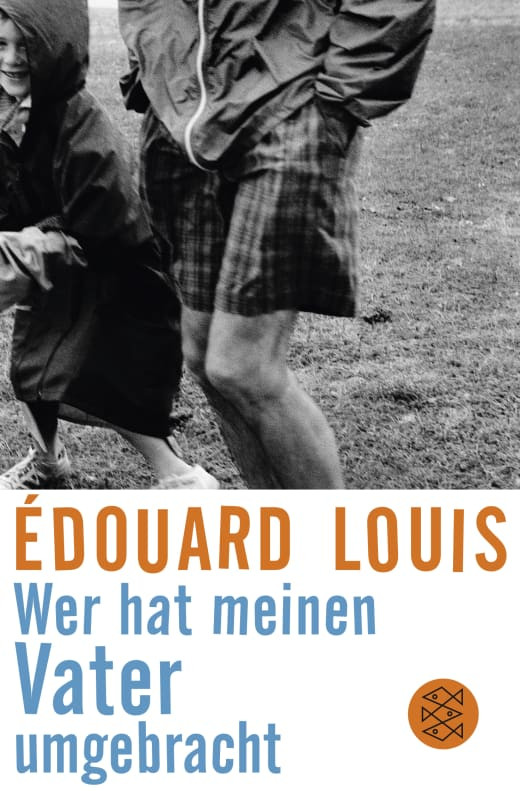
Irgendwo hinter der Bühne ist Thomas Ostermeier. Der Regisseur und künstlerische Leiter der Schaubühne Berlin hat mit Édouard Louis „Wer hat meinen Vater umgebracht“ für die Bühne adaptiert. Louis’ dritter, sein schmalster Roman – und jener, mit dem er am zufriedensten ist. Es ist ein Brief an seinen Vater, der nie beantwortet wird. Bereits im Vorwort stellt Louis klar: »Dass nur der Sohn spricht, ausschließlich er, ist für beide brutal: Dem Vater bleibt verwehrt, seine eigene Lebensgeschichte zu erzählen, und der Sohn ersehnt sich eine Antwort, die er niemals erhalten wird.« Das Buch wird oft als Versöhnung mit dem Vater beschrieben, doch das stimmt nicht. Es ist ein Versuch des Sohnes, die Strukturen zu verstehen, die seinen Vater zum homophoben Rassisten, zum brutalen Mann machten: Es seien die politischen Entscheidungen aus Paris, die ihn zerstört haben. Politiker, die ihn zwangen zu arbeiten, obwohl er wegen eines Unfalls arbeitsunfähig war. Es erinnert an eine Theorie des Philosophen Pierre Bourdieu: Der Arbeiterklasse wird der Zugang verwehrt zur Bildung, zum Kapital, zur Kultur – und somit zur Welt. Alles, was man ihnen lässt, ist der Körper. Es entsteht gezwungenermaßen eine Ideologie des Körpers. Die Maskulinität wird zum Wichtigsten, weil nur sie bleibt. Édouard Louis’ Vater ging fast daran zugrunde, unbedingt einem Männlichkeitsideal genügen zu wollen, mit dem er sich selbst nie wohlfühlte, so schätzt Louis das ein.
Während der Adaption fürs Theater steht Louis in einer Szene wie immer allein auf der Bühne, ein braunes Ledersofa und ein Plastikstuhl deuten das Wohnzimmer seines Elternhauses an. In seinem Monolog ertappt er seinen Vater beim Schauen einer Oper im Fernsehen. Bei einer Arie fangen die Augen des Vaters feucht zu glänzen an. »Du, wo du doch immer sagtest, ein Mann dürfe nicht weinen«, sagt Louis, »wie gerne hätte ich zu dir gesagt: Ich weine auch. Oft sogar sehr.«
Später geht es um seinen Lieblingsfilm der Kindheit, „Titanic“. Er war acht Jahre alt, wollte ihn unbedingt als Videokassette haben, hat gebettelt und gefleht. Er weiß nicht mehr, was die Faszination auslöste. Die Liebe, der gemeinsame Traum von Kate Winslet und Leonardo DiCaprio? Er bekam die Videokassette tatsächlich und schaute sich den Film, wie er sagt, ein Jahr lang etwa zehn Mal pro Woche an. Jetzt wird „My Heart Will Go On“ gespielt, der „Titanic“-Song schlechthin. Louis tänzelt auf der Bühne, singt mit, wartet den Höhepunkt ab: »You’re here, there’s nothing I fear« – und rutscht auf den Knien den Zuschauern entgegen. Er bewegt seine Lippen zum Text und singt in ein imaginäres Mikrofon zwischen seinen Fäusten. »You’re here, there’s nothing I fear / And I know that my heart will go on.« Die Szene hätte auch im Stück von Milo Rau vorkommen sollen.
Den Film „Titanic“ sah Louis, wie er sagt, ein Jahr lang zehn Mal pro Woche
Die brisanteste Stelle des Abends ein wenig später: Édouard Louis hängt Gesichter aus Karton an eine Wäscheleine. Es sind die Staatspräsidenten Frankreichs, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Sie persönlich seien schuld am miserablen Leben seines Vaters und somit auch am miserablen Jugendleben von Louis. Sie hätten den Körper seines Vaters zerstört und ihn so zugerichtet, wie er jetzt ist: Gerade 55, er könne kaum gehen, nachts brauche er ein Sauerstoffgerät. Louis nimmt eine Handvoll Knallkörper und wirft sie auf die Gesichter aus Karton – dort explodieren sie. Später wird Thomas Ostermeier sagen, das sei vielleicht zu vordergründig argumentiert. Er würde sich auch davor hüten, das Theater mit Weltrettungshoffnungen zu überfrachten – denn was auf der Bühne geschehe, bleibe auf der Bühne. Der wahre Protest, der Kampf, finde auf der Straße statt. Wie in ein paar Tagen auf der Demonstration »Gerechtigkeit für Adama«. Das Theater könne da wenig ausrichten. Und Édouard Louis wird widersprechen: Wie könne er als Regisseur nur so denken? Er sei der festen Überzeugung, dass Theater die Realität verändere, sonst würde er keine Minute mehr in solchen Häusern verbringen, und auf der Bühne schon gar nicht.
Kurz nach der Knallkörperszene ist der letzte Satz des Stückes ein Zitat des Vaters: »Was es bräuchte, das ist eine ordentliche Revolution.« Danach wird es dunkel auf der Bühne, das Stück ist aus. Der Applaus von Venedig ist erst verhalten – als bestünde die Befürchtung, man würde nicht das Stück, sondern die Aussage bejubeln. Nach Revolution sehnt sich hier niemand. Wer in schwarzer Abendrobe ins Theater Goldoni kommt, kann bei einem Aufstand eigentlich nur verlieren. Nur Adam Eli springt auf und hüpft und tanzt und applaudiert.
Nach der Vorstellung, bei einem gemeinsamen Abendessen in einem Restaurant nahe dem Theater, packt Adam Eli Édouard Louis bei den Schultern, schüttelt ihn und drückt seine Wange an die von Louis. »Ich bin so stolz auf dich, mein Freund«, sagt er. Ostermeier bestellt Wein, und Eli, als hätte er die Lebensfreude aus New York mitgebracht, steht auf und ruft: »Wenn du schwul bist, wirst du nie alt! Wir bleiben für immer jung, Édouard.« Es ist ein anderer Louis an diesem Abend, einer, den nur seine guten Freunde kennen: ein Mann, der Wein liebt, guten Champagner und Schokolade, Musicals und „cheap pop songs“, einer, der lacht und blödelt, der von seinem Treffen mit Isabelle Huppert erzählt und dabei Isabelle Huppert imitiert und sich selbst gleich mit. Einer, der, wie er sagt, hemmungslos ins Leben verliebt ist. »Wenn ich liebe, dann liebe ich mit allem, was ich habe.« Er kippt seine Hand zur Seite, spricht in heller Stimme, überschlägt seine Beine und kreischt, sagt dann: »I am so sorry, I am just a very gay boy.« Eli lacht laut auf. »Wir leben für immer!«, ruft er noch, es ist zwei Uhr nachts, und die Straßen Venedigs sind leer.

Direkt von Venedig will Louis nach Cannes fliegen, zum Filmfestival, roter Teppich, sein bester Freund Didier Eribon stellt die Verfilmung seines Buches „Rückkehr nach Reims“ vor. Das Leben ist schön. An diesem Abend des Feierns scheint die Revolution plötzlich nah. Wie Adam Eli sagt: »Schwul und queer zu sein, das hat viele Nachteile. Aber es ist auch verdammt schön. Und das zu zeigen, ist sehr politisch. Wer sagt, dass es kein lustvoller Kampf sein kann?«
Die Szenerie erinnert in ihrer Intensität und im Kontrast zum verzweifelten Schriftsteller Louis in Paris an eine Stelle im Roman „Wer hat meinen Vater umgebracht“, Louis spricht seinen Vater dort wieder direkt an: »Du hast mit aller Macht darum gekämpft, jung zu sein, fünf Jahre lang, bist nach Südfrankreich gezogen, dachtest, dort unten ist wegen der Sonne das Leben schöner, weniger beschwerlich, du hast Mopeds geklaut, ganze Nächte durchgemacht, getrunken, so viel es ging. Du hast all das so intensiv und so aggressiv wie nur möglich gelebt wegen der Empfindung, dass es etwas war, das du stehlen musstest – genau, darauf wollte ich hinaus: Den einen wird die Jugend geschenkt, den anderen bleibt nichts anderes übrig, als sie sich zu stehlen.«
»Müssen auch Sie Ihre Jugend zurückstehlen?«
»Ich muss nicht stehlen. Mein Leben erlaubt mir, diese Jugend zu behalten. Ich stelle mir jeden Tag die Frage, wie ich leben will. Mein Vater hat sich diese Frage nie gestellt. Sein Leben war eine Norm, unter der er gelitten hat. Ich bin sicher, er wollte es anders.«
»Dennoch wünschte er sich eine Revolution.«
»Ja, er hat schon gespürt, dass da was nicht passt.«
»Wie unterscheidet sich Ihre Vorstellung einer Revolution von der Ihres Vaters?«
»Früher war die Revolution meines Vaters: Schwule und Araber beseitigen. Aber jetzt schließt er sich immer mehr meiner an.«
»Einem Kampf gegen die Gewalt im Allgemeinen?«
»Ja, gegen eine Gewalt der jeweils dominierenden Klasse. In Europa herrscht eine brutale Ungleichheit. Die Menschen vergessen, dass es in der Politik um Leben und Tod geht. Gehört man der falschen Klasse an, stirbt man früher.«
»Wie meinen Sie das?«
»Ein Arbeiter hat ein hohes Risiko, früh an Organversagen zu sterben. Eine Person of Color hat ein erhöhtes Risiko, an Polizeigewalt zu sterben.«
»Wie wollen Sie das ändern?«
»Ich weiß es nicht. Aber ich bediene mich des radikalsten Instruments, das ich habe: meiner Stimme. Ich schreibe gegen die Gewalt an.«
»Sie schreiben, Politik zu erleben heiße für die meisten, Ohnmacht zu erleben.«
»Ja, und dennoch sind politische Entscheidungen gerade für die Ärmsten sehr konkret und intim. Sie merken es, wenn der Treibstoff teurer wird. Sie merken Sozialkürzungen. Den Besserverdienern ist das egal – die dominante Klasse wird von der Politik beschützt, durch Macron sogar noch mehr.«
»Sie schreiben kaum über die schönen Dinge in Ihrem Leben, die Freundschaften, den Sex, den guten Wein, die Musik.«
»Die schönen Dinge sollen erlebt werden, die grausamen festgehalten. Ich schreibe für meine Feinde. Ich will sie verunsichern. Es ist ein Protestmarsch.«
»Was dachten Sie, als 2019 die Gelbwesten die Champs Élysées in Brand setzten?«
»Ich habe mich so gefreut. Für einen kurzen Moment hatte die dominierende Klasse richtig Angst.«
»Ist das nicht auch Gewalt?«
»Nein, es ist ein Zeichen: Wir meinen es ernst. Entweder ihr hört auf uns, oder ihr seid nicht mehr sicher. Wir sind viele, und wir geben nicht auf. Das müssen wir auch bei der Demonstration ›Gerechtigkeit für Adama‹ zeigen. Es ist die wichtigste Demo des Jahres.«
Neun Tage nach Venedig, am 17. Juli 2021, hat sich die Protestbewegung um Assa Traoré am Bahnhof von Beaumont-sur-Oise versammelt, etwa dreißig Kilometer nördlich von Paris. Von hier wollen sie bis vor die Polizeistation ziehen, wo ihr Bruder Adama vor fünf Jahren starb. In Zügen kommen zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Paris an. Auf Protestschildern steht: »Gerechtigkeit für Adama und alle Opfer«. Die Stimmung ist friedlich, doch Assa Traorés Blick gibt zu verstehen: Dies ist keine Party, es ist ein Kampf. Aus einem Bus steigt eine Gruppe der LGBTQ-Community, mobilisiert von Édouard Louis über Instagram. »Wir sind vereint in unserem Leid«, sagt Traoré. »Mein Kampf vermengt sich mit deren Kampf – gemeinsam für Gerechtigkeit!« Irgendwann kommen keine Züge mehr – Traoré vermutet, dass die Regierung wie jedes Jahr die Fahrpläne geändert hat. Etwa tausend Demonstranten sind es am Ende, weit weniger als erwartet. Und anders als in Paris, wo jede Demonstration von vielen, teils schwer bewaffneten Polizisten flankiert wird, ist hier niemand. Assa Traoré hat vorsorglich ihre eigene Security mitgebracht, Cousins und Freunde mit trainierten Oberarmen. Eine Gegendemonstration bleibt aber aus. An der Ortseinfahrt regelt ein Polizist lediglich den Verkehr. Er sagt: »Unser Boss hat uns nicht erlaubt, die Demo zu bewachen. Er hat Angst um uns.«
Vor der Polizeistation hält der Protestzug, Traoré schreit ins Mikrofon: »Hier musste mein Bruder einen elenden Tod sterben. Gerechtigkeit für Adama!« Die Masse schreit: »Gerechtigkeit für Adama!« Und wieder Traoré: »Gerechtigkeit für Adama!« Und wieder die Masse: »Gerechtigkeit für Adama!« Édouard Louis ist nicht dabei. Er hat Traoré abgesagt.
Am nächsten Tag im Apartment von Assa Traoré, einer kleinen Mietwohnung in einem Gebäudekomplex, gated community, zwei schwere Tore mit vierstelligen Codes. Seit ein rechtes Magazin ihre Adresse veröffentlicht hat, geht sie oft nur mit Begleitung raus – erst vergangene Woche hat sie Anzeige erstattet, weil sie vom Balkon beobachtet hatte, dass ein Mann ihr auflauerte. Ihre Stimme ist angegriffen vom Schreien, erschöpft sitzt sie am Tisch und beantwortet Sprachnachrichten in Gruppenchats: »Danke meine Lieben, euretwegen bleibe ich stark!« Vor einem halben Jahr wurde sie vom Magazin “Time” als »Guardian des Jahres« ausgezeichnet. Alle ihre Exemplare hat sie verschenkt, sie selbst hat keines mehr. »Zu kämpfen heißt zu teilen«, sagt sie. Gerade sei der Prozess gegen sie in eine brenzlige Phase gegangen. Traoré prüft ihr Handy. Auch Louis hat ihr geschrieben, er will wissen, wie es war. Warum er ihr für die Demonstration abgesagt hat, weiß sie nicht. »Er meinte, er sei eben irgendwo anders«, sagt sie.
Knapp 800 Kilometer weiter südlich sitzt Édouard Louis einen Tag später im Julihalbschatten des »Café Le Forum« und trinkt stilles Wasser. Er ist in Aix-en-Provence, einem südfranzösischen Heileweltstädtchen, wo er mit seiner Wahlfamilie verabredet ist, Didier Eribon und Geoffroy de Lagasnerie. Sie leben in unterschiedlichen Apartments und sehen sich zum Frühstück und am Abend. Sie gehen ins Theater, schauen sich „Tristan und Isolde“ an und hören Musik von Strauss.
»Sie waren nicht auf der Demo. Sind Sie aus Paris geflohen?«
»Ja, ich hielt es nicht mehr aus. Ich wollte verschwinden.«
»Wie lange?«
»Am liebsten für immer. Ich lebe ein Leben, das ich verlassen will.«
»Was hindert Sie daran?«
»Ich habe noch so viel zu sagen. Wie könnte ich aufhören zu schreiben und zu kämpfen, wenn wir von so großer systematischer Gewalt umgeben sind?«
»Haben Sie Angst zu sterben, ohne alles gesagt zu haben?«
»Ja, sehr. Der Tod ist der größte Skandal. Und er kommt immer näher. Ich vermisse meine Kindheit.«
»Édouard Louis vermisst seine Kindheit?«
»Ja, der Tod war damals außer Reichweite.«
»Hassen Sie Ihren Vater noch?«
»Freunde fragen mich das oft. Und ich sage immer: Klar hasse ich ihn. Aber das stimmt nicht. Es wird nur von mir erwartet, dass ich ihn hasse. Aber ich für mich weiß, dass ich ihn wohl liebe.«
»Haben Sie ihm verziehen?«
»Nein, dafür sind zu viele Dinge passiert, die nicht mehr gutgemacht werden können.«
»Arbeiten Sie gerade?«
»Nein, ich mache frei.«
»Sind Sie glücklich?«
»Ja, zum ersten Mal in den vergangenen Monaten. Solange ich arbeite, gibt es diese Schwere. Das Glück kommt dann, wenn ich aufhöre.«
Louis trifft sich mit Didier Eribon und Geoffroy de Lagasnerie. Sie gehen ins Kino, sie arbeiten nicht. Eribon watschelt in Sandalen, Dreiviertelhose und Stoffhut auf Louis zu. Louis streckt seine Arme aus und sagt zu ihm: »Komm her, mein deutscher Tourist!« Die drei lachen, und der Abend scheint leicht zu werden wie einst die Nacht in Venedig.
Gleichzeitig, nicht weit von ihnen, ebenfalls in der Provence, verbringt Milo Rau seinen Sommerurlaub in einem Häuschen mit seiner Familie. Jeden Abend arbeitet er. Er sitzt auf dem Dorfplatz und zoomt mit UNESCO und Seebrücke, mit beiden plant er Projekte. Neben ihm chillen Jugendliche, trinken Desperados-Bier und Whisky, rauchen Gras und hören französischen Rap.
Vor Kurzem war Rau auf einem Theaterfestival in Avignon. Louis sei auch dort gewesen, die beiden haben sich nicht getroffen. »Wir haben in unserer Zusammenarbeit keinen gemeinsamen Landungspunkt gefunden«, sagt er. »Ich bin der Überzeugung, dass die Projekte einen Impact jenseits der Bühne haben müssen. Dass das Biografische allein nicht mehr reicht. An diesem Konflikt sind wir künstlerisch gescheitert – auch wenn es meine Freundschaft zu ihm nur vertieft hat.« Immer wieder würden sie einander Textnachrichten schreiben. Sie wollen auch wieder zusammenarbeiten.
Es scheint, als kämpften die beiden den gleichen Kampf, für den sie bloß noch keine gemeinsame Form fanden. Zwei Radikale, die ihre Radikalität noch nicht zu bündeln wissen. Und vielleicht hat Thomas Ostermeier recht, wenn er sagt, Literatur und Theater könnten nur Katalysatoren eines Kampfes sein, nie aber der Kampf an sich. Verhandelt wird immer noch auf der Straße, wo Assa Traoré vor der Polizeistation ihre Parolen brüllt, oder im Gerichtssaal, wo sie anklagt und weint. Dort also, wo nicht gespielt wird, wo nicht so getan wird, als ob. Assa Traoré hat den Prozess schließlich gewonnen, sie wurde freigesprochen, doch das zählt schon bald nicht mehr viel. Die Freude von Louis und Rau, von Traoré, Eli und Ostermeier ist von kurzer Dauer. Wer sein Leben dem Kampf für andere unterwirft, dem ist das eigene Glück nicht genug.

Gabriel Proedl
lebt als Autor und Reporter in Wien und Berlin. Seine Reportagen, Porträts und Interviews erscheinen in DIE ZEIT, dem ZEIT Magazin und dem Magazin der Süddeutschen Zeitung. Seine Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet, etwa mit dem österreichischen Zeitschriftenpreis. Als Dozent lehrt er die „literarische Reportage“ und die „Modereportage“ an Universitäten und Fachhochschulen.
Instagram: @gabrielproedl